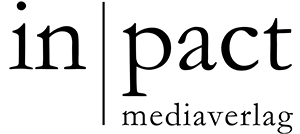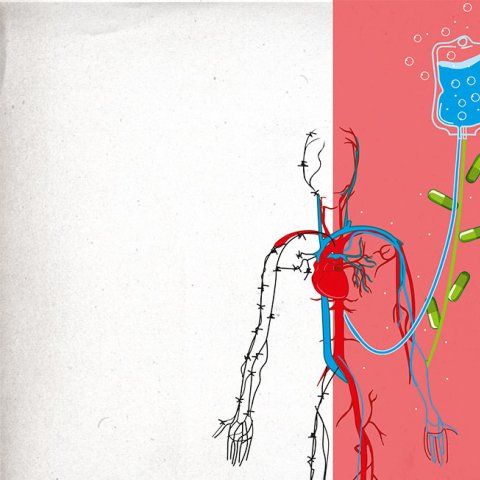Arztpraxen, Kliniken, Labore und nicht zuletzt Apps oder einfache Wearables wie der modische Fitnesstracker fürs Handgelenk erheben inzwischen unzählige individuelle, elektronische Daten zur Gesundheit jedes Einzelnen. Dem deutschen Digitalverband Bitkom zufolge gibt es zur Zeit bereits mehr als 70.000 Apps, die medizinische Informationen verarbeiten. Sie eröffnen die Tore zu einer Personalisierten Medizin, die etwa bei der Behandlung von Seltenen Erkrankungen (Orphan Deseases) und Krebs immer wichtiger wird.
Computer entwickelt Therapie
„Watson“, der IBM-Supercomputer, gilt schon heute als wahres Diagnosewunder. Watson berechnet anhand gespeicherter Daten die genetische Zusammensetzung von Krebstumoren, erkennt, welche Mutationen die bösartigen Gewebewucherungen verursachen und findet passende Medikamente. Der Computer verarbeitet Informationen aus so unterschiedlichen Quellen wie der gesprochenen Sprache, aus Patientenakten oder klinischen Studien. Er ist lernfähig im Hinblick auf seine Fähigkeiten, Informationen aufzunehmen und er kann Hypothesen erstellen, die Ärzte dann überprüfen. Mithilfe präziser Datensammlungen können so Medikamente entwickelt werden, die immer individueller auf die Patienten zugeschnitten sind.
Der Vorteil der medizinischen Datenflut liegt auf der Hand: Systematisch gesammelt, klassifiziert, verglichen und gespeichert kann die Auswertung der Informationen dazu beitragen, Diagnostik, individuelle Prävention und Therapie, die Partizipation der Patienten an der Behandlung und sogar die Kommunikation mit dem Arzt zu verbessern. „Allein die molekulare Medizin hat im Jahr 2015 mehr Daten erzeugt als im gesamten Zeitraum von 1990 bis 2005“, sagt Burkhard Rost, Professor für Bioinformatik an der Technischen Universität München (TUM). Mit Hilfe einer datenbasierten Diagnostik kann die personalisierte Medizin die genetischen und zellulären Besonderheiten von einzelnen Patienten oder von bestimmten Gruppen erfassen und daraus passende Therapien ableiten. Bewährt hat sich die Präzisionsmedizin unter anderem bereits bei Patienten mit Haut-, Lungen- oder Brustkrebs, bei Darm-, Prostata- oder Lymphdrüsenkrebs.
„Betrachten wir einmal die Proteine, also die Eiweißstoffe in unserem Körper“, sagt Rost. „Wir besitzen etwa 20.000 Varianten, und ein Viertel davon unterscheidet sich bei zwei Personen ganz essentiell.“ Dies kann sich auf den Erfolg einer Chemotherapie auswirken. Manche Tumore sind gegen bestimmte Mittel unempfindlich, oder der Wirkstoff wird von den Krebszellen unschädlich gemacht. Liegen entsprechende Daten vor, kann eine Therapie so auf den Patienten abgestimmt werden, dass ihm unnötige Belastungen erspart, Therapieerfolge verbessert und Kosten gesenkt werden.
Seltene Erkrankungen besser behandeln
Obwohl in der Europäischen Union eine Krankheit als selten gilt, von der nur maximal fünf von 10.000 EU-Bürgern betroffen ist, leidet damit doch eine relativ hohe Anzahl von Menschen an sogenannten „Orphan Diseases“. Rund ein Fünftel der Medikamente, die jährlich neu auf den Markt kommen, sind „Orphan Drugs“, sagt der vfa, der Wirtschaftsverband forschender Pharmaunternehmen. Seltene Krankheiten gibt es in allen medizinischen Fachgebieten. Fast immer ist es schwer, sie auf Anhieb zu erkennen. Ohne Vergleichsdaten tappen Mediziner häufig im Dunkeln. Zu den „seltenen Krankheiten“ zählen beispielsweise Störungen der Blutgerinnung, Krankheiten wie Morbus Gaucher oder Morbus Fabry, bei denen es zu Organschäden kommt, weil im Körper bestimmte Stoffe nicht mehr abgebaut werden können, aber auch Krebskrankheiten wie Nierenzellkarzinom, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Leukämie.
Durch die Analyse natürlich auftretender genetischer Informationen in den Proteinen des menschlichen Körpers wollen Burkhard Rost und auch Hans-Werner Mewes, Professor für Genomorientierte Bioinformatik an der TUM, herausfinden, welche Mutationen für seltene Krankheiten verantwortlich sind. „Mit klassischen Methoden sind sie fast unmöglich zu erkennen, meist braucht es fünf bis 20 Jahre bis zur klinischen Diagnose“, sagt Mewes. „Wenn jedoch der genetische Defekt gefunden ist, weiß man in 25 bis 40 Prozent der Fälle ganz genau, ob man gezielt therapeutische Maßnahmen ergreifen kann.“
Vor Risiken und Nebenwirkungen wird angesichts von „Big Data“ allerdings gewarnt. Wie wird die Anonymisierung der Patienteninformationen gewährleistet und wie die Sicherheit von Speichersystemen, Rechnern und Datenbanken? Zudem fehlen die Strukturen, um die Informationen fächerübergreifend für Medizin, Biologie und Informatik zu bündeln. Ungeklärt bleibt die Frage, wer die oft noch völlig ungeordnet vorliegenden Daten aus Laboren, Studien oder Genomforschung auswertet.
Einer Studie des unabhängigen Beratungsunternehmens ePrivacy zufolge, gab es in 2015 bei 80 Prozent von 140 untersuchten Medical Apps die Möglichkeit Login-Daten abzufangen, bei weiteren 75 Prozent konnten Gesundheitsdaten manipuliert werden und 57 Prozent boten keine Datenschutzerklärung.
Bewusstsein für den Datenschutz fehlt
Abhilfe schaffen sollen Zertifikate für die entsprechenden Produkte, die nur dann erteilt werden, wenn nationale und europäische Datenschutzgesetze vorbildlich eingehalten werden. „Im Gegensatz zu Angriffen auf die Infrastrukturen von Privatpersonen oder vielen Unternehmen stellen Angriffe auf IT-Strukturen im Gesundheitswesen (z.B. in Kliniken) eine Bedrohung von Menschen, konkret von Patienten dar“, warnt Prof. Christian Johner auf seinem Institutsblog. „Fällt wie bereits geschehen die IT einer Klinik aus, kann sie keine Patienten aufnehmen und muss OPs verschieben. Wenn der Angriff die Beatmungsgeräte einer Intensivstation trifft, können Patienten innerhalb von Minuten versterben“.
Unternehmen im Gesundheitsbereich und Kliniken investieren oft viel zu wenig in die IT, die Infrastrukturen sind unübersichtlich und auch Hersteller und Softwareentwickler handeln oft blauäugig. Die Gründe hierfür liegen unter anderem darin, dass konkrete Vorgaben zur Sicherheit bei Medizinprodukten fehlen. Vielfach fehlt einfach noch das Verständnis für die Bedrohung der IT-Sicherheit durch die völlige Vernetzung von IT und Medizintechnik, kritisiert der Wissenschaftler.

Illustration: Ivonne Schulze